Region ist auf der Consumenta vertreten

Landrat Gerhard Wägemann und die Altmühlfränkische Bierkönigin Sarah I. (rechts) sowie Braumeister Werner Gloßner („Felsenbräu Thalmannsfeld“/links) prosten mit Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Foto: ZIA
Bundeslandwirtschaftsminister und Bierkönigin besuchen Altmühlfranken auf der Consumenta 2016
Gleich am ersten Messetag der Consumenta durfte Landrat Gerhard Wägemann königliche und politische Prominenz am Stand von Altmühlfranken begrüßen. Neben der altmühlfränkischen Bierkönigin „Sarah I.“ gab sich auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt die Ehre und fand lobende Worte für Altmühlfranken und seine hervorragenden Regionalprodukte.
Am vergangenen Sonntag fiel der Startschuss für die 10 Tage dauernde Consumenta in Nürnberg und Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt lobte bei seinem Besuch den Auftritt Altmühlfrankens auf dieser größten Verbrauchermesse Bayerns. Landrat Gerhard Wägemann und die altmühlfränkische Bierkönigin Sarah I. nutzten diese Gelegenheit auch prompt dem Gast aus Berlin die kulinarische Qualität Altmühlfrankens näher zu bringen. Und so durfte sich der Minister über eine Kostprobe altmühlfränkischen Bieres und altmühlfränkischer Bratwurst freuen. Und diese mundete nicht nur ihm, sondern auch den vielen anderen Teilnehmern des Eröffnungsrundgangs.
Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen präsentiert sich noch bis zum 01. November 2016 auf einer Fläche von 160m² und mit 15 regionalen Mittausstellern auf der Consumenta in Nürnberg in Halle 9, Stand A04 unter dem Motto: „Entdecken. Sie. Hier.“ und „Erleben. Sie. Hier“. Weitere Informationen unter www.altmuehlfranken.de/consumenta.






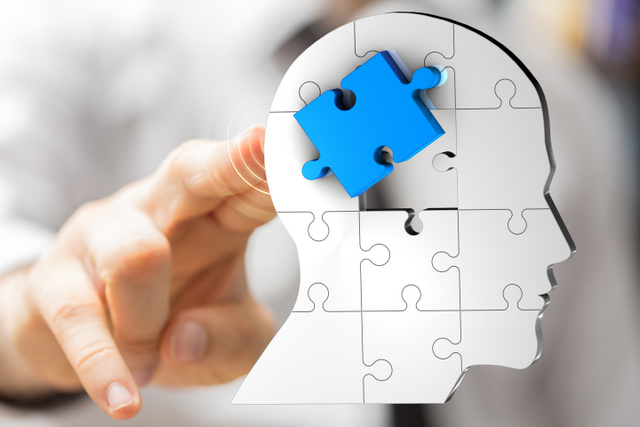






Neueste Kommentare