Schutz der Steinerne Rinne in Hechlingen

Am Hang des Hahnenkamms bei Hechlingen schlängelt sich ein ungewöhnlicher Wasserlauf durch den Wald – die Steinerne Rinne. Sie ist ein ganz besonderes und schützenswertes Biotop. Denn Steinerne Rinnen entstehen nur dort, wo oberhalb eines steilen Abhangs kalkhaltiges Quellwasser austritt, beim Bergabfließen stark bewegt und gut mit Luft durchmischt wird. In diesem Fall kann sich entlang des Wasserlaufes auf Moosen und Algen Kalk ablagern: Kalktuff entsteht. Wenn auf diesen Ablagerungen wieder frisches Moos wächst und sich der Vorgang wiederholt, wächst das Bachbett langsam in die Höhe – eine Steinerne Rinne entsteht.
Im Naturpark Altmühltal gibt es Steinerne Rinnen vor allem am Hahnenkamm bei Meinheim und Hechlingen. Aber auch an den Hängen des Altmühltals und seiner Seitentäler, zum Beispiel bei Beilngries und Berching kann man sie finden. Sie stehen als FFH-Lebensraum unter Schutz.
Steinerne Rinnen sind für Erholungssuchende und Naturfreunde gleichermaßen starke Anziehungspunkte, jedoch ist ihre Unberührtheit in Gefahr. In den weichen und sumpfigen Böden rund um die Rinnen entstehen schnell Trittspuren und Schäden. Auch am empfindlichen Kalktuff selbst richten unachtsames Betreten, Berühren und Spielen durch Kinder oder Hunde immer wieder Schaden an. Dadurch kann das Wachstum des Kalktuffs unter Umständen über Jahre hinweg gestört werden.
Zum Schutz der Steinernen Rinnen und der umliegenden Natur ist es deshalb unerlässlich, die Wanderwege entlang der Steinernen Rinnen so zu führen, dass diese gut betrachtet, aber nicht berührt werden können. Die Initiative zu diesem Projekt kam bereits vor einigen Jahren von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Nun konnte im Herbst 2023 / Frühjahr 2024 das Projekt durch den Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb) e. V. erfolgreich umgesetzt werden. Unterstützt wurde das Projekt durch die Regierung von Mittelfranken und gefördert durch das Bayerische Umweltministerium.
So wurden bereits bestehende Wege mit Stufen am Hang und kleinen Stegen ertüchtigt. Auch markieren nun Geländer die begehbaren Wege, eine Informationstafel klärt über die Maßnahmen und das notwendige Verhalten der Besucherinnen und Besucher auf. Die Holzrinne, die das Wasser der Steinernen Rinne zuleitet, wurde ebenfalls ertüchtigt und der abschüssige Hang entlang des Weges befestigt. Auf diese Weise kann in Zukunft den Besucherinnen und Besuchern ein ungestörtes Naturerlebnis ermöglicht werden, während gleichzeitig die Steinernen Rinne und der sensible Kalktuff geschützt werden.
Diese für Mensch und Natur zufriedenstellende Lösung wurde in enger Zusammenarbeit des Vereins Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb) e.V. mit Projektleiterin Christa Boretzki und Naturparkrangerin Ann-Katrin Stockinger mit der unteren Naturschutzbehörde, dem Markt Heidenheim, dem Eigentümer der Fläche und der beauftragten Garten- und Landschaftsbaufirma erarbeitet und umgesetzt.
Beim gemeinsamen Projektabschluss am 17. Juli direkt an der Steinernen Rinne waren zudem Landrat Manuel Westphal, Naturpark-Geschäftsführer Christoph Würflein, die Bürgermeisterin des Markts Heidenheim, Susanne Feller, der Ehrenbürger des Markts und langjähriger Vorstand des Fremdenverkehrsvereins Hechlingen, Ernst Högner sowie Doris Baumgartner für die Untere Naturschutzbehörde und Anja Holzinger für die Regierung Mittelfranken zu Gast.





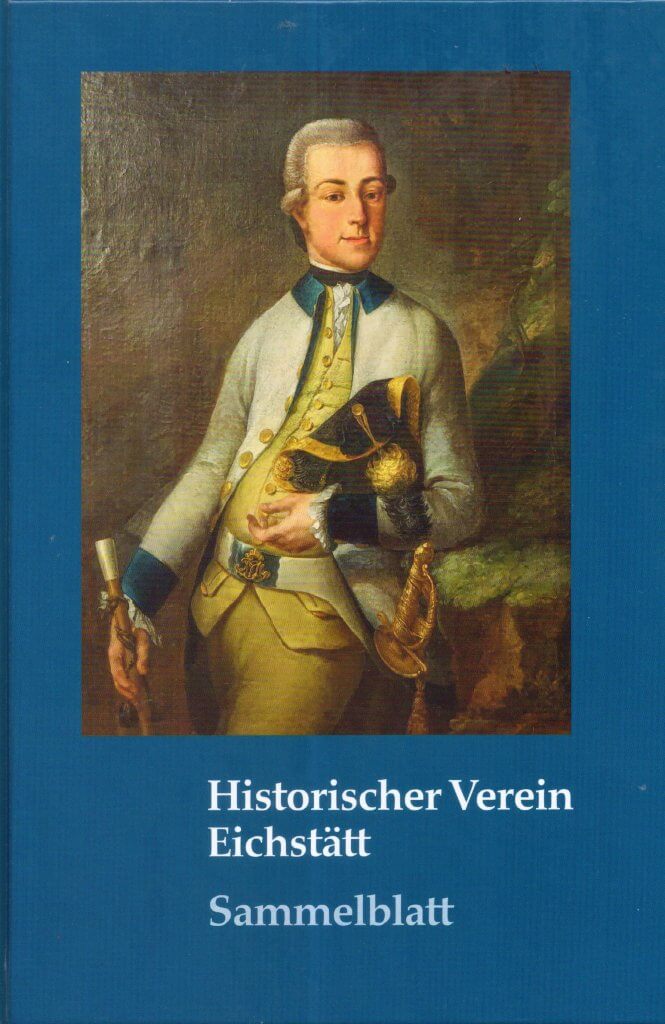


Neueste Kommentare