70. Jahrbuch des Vereins für Heimatkunde seit 1923
Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten ist „Alt-Gunzenhausen“, das Jahrbuch des Vereins für Heimatkunde Gunzenhausen, erschienen. Zwölf Beiträge von zehn Autoren beleuchten die lokale Historie auf 272 Seiten. Das erste Exemplar überreichte Vorsitzender Werner Falk im Rathaus an Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Die seit 1923 Jahren erscheinende Publikation wird von der Stadt finanziell gefördert.

Das neue Jahrbuch „Alt-Gunzenhausen“ präsentierten Vorsitzender Werner Falk (rechts) und sein Stellvertreter und Stadtarchivar Werner Mühlhäußer (links) Bürgermeister Karl-Heinz Fitz.
„Unser Schriftleiter und 2. Vorsitzender Werner Mühlhäußer ist zugleich der Stadtarchivar. Das ist eine Personalunion, die der Stadt und dem Verein nützt.“ Bei der Vorstellung des 70. Jahrbuchs hob der Vorsitzende hervor, dass die Autoren von „Alt-Gunzenhausen“ alle unentgeldlich forschen und schreiben. „Indem sie immer wieder neue Facetten der Stadt- und Regionalgeschichte darstellen, verdienen sie öffentliche Anerkennung und Respekt“, betonte der Vereinsvorsitzende. Er dankte auch dem Bezirk Mittelfranken, Landrat Gerhard Wägemann und der Sparkasse Gunzenhausen für die immerwährende Unterstützung. Der 305 Mitglieder zählende Geschichtsverein sei stets bemüht, neue Freunde zu gewinnen. Falks Werbetrommel: „Die Jahresgabe Alt-Gunzenhausen gibt es für unsere Mitglieder gratis. Das ist ein einmalig günstiges Angebot bei einem Jahresbeitrag von nur 18 Euro.“
Dass die Beiträge wissenschaftlich fundiert sind, das ist für Werner Mühlhäußer das Qualitätsmerkmal von „Alt-Gunzenhausen“. Dem Stadtarchivar gelingt es immer wieder, dem Verein neue Autoren zuzuführen und den „Stamm“ bei der Stange zu halten. Er begleitet die Autoren fach- und sachkundig.
Zum Inhalt der Publikation
Zur Finanzierung drohender Kriege, vornehmlich zur Abwehr der „Türkengefahr“ hat Kaiser Maximilian I. 1495 den „Gemeinen Pfennig“ eingeführt. Werner Kugler greift den damals auf vier Jahre begrenzten „Soli“ auf und erläutert am Beispiel der Heidenheimer Klosteruntertanen die steuerliche Belastung, zudem veröffentlicht er die Steuerlisten von 43 Orten.
Ein Gemälde von 1606 interpretieren Karl Rieger und Hermann Thoma („Die missglückte Sauhatz des Grafen von Graveneck, Pfleger von Arberg“). Es befindet sich im Markgrafenmuseum Ansbach und zeigt szenische Darstellungen der Saujagd. Die Autoren verorten das Ölbild des unbekannten Malers in die Landschaft zwischen Kemmathen und Großlellenfeld.
Hermann Thoma, der sich in den Jahrbüchern 2005 und 2006 mit den „Hexenverfolgungen im Oberen Stift des Hochstifts Eichstätt“ befasst hat, fügt 2015 einen Teil III hinzu und widmet sich ausgiebig dem Schicksal der Apollonia Veit aus Ornbau, die 1616 durch das Schwert hingerichtet und verbrannt wurde. In einer Kastenamtsrechnung hat er im Untertitel „Henkerkosten“ die Geschichten von 18 weiteren Frauen gefunden und zeichnet ihre „Straftaten“ akribisch auf. Thoma hofft, dass sich die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt zu einer umfassenden wissenschaftlichen Aufarbeitung der Hexenverfolgungen durchringen kann.
Die mittelalterlichen Herrschaftsverhältnisse im Mittelalter beschreibt Siglinde Buchner in ihrem Beitrag „Dittenheim und Sausenhofen, ihre Dorfherren und ihre vergessenen Turmburgen“. Die Grafen von Oettingen und die Marschälle von Pappenheim teilten sich die Untertanen untereinander auf. Es waren keine Wehranlagen und Schlösser, sondern Wohnanlagen, deren Standorte sie verortet.
Siglinde Buchner, die auch ehrenamtliche Archivpflegerin des Landkreises ist, erläutert die 13 Blätter der „Dorfordnung von Gnotzheim aus dem Jahr 1662“, die noch im Original vorliegt. Im „Gericht-Buch“ geht es um alte Flurnamen, die heute noch gebräuchlich sind (Furzwiesen, Wolfsbuck, Galgenwiese), aber auch um Vieh- und Gänsehirten.
„Die Pfarrei Degersheim und ihre Gemeindeglieder am Ende des 17. Jahrhunderts“ listet Werner Kugler auf. Er kann sich auf ein Familienregister aus dem Jahr 1692 stützen. Es enthält alle Namen der Gemeindeglieder, auch die Zahl der Kinder, Mägde und Knechte. Angelegt hatte es Pfarrer Ernst Heinrich Friedlein, der auch in Meinheim und Ursheim tätig war.
„Die Gemeindeflur der Stadt Gunzenhausen und ihre Verwaltung im 19. Jahrhundert“ beschreibt Werner Neumann anhand der Flurordnung von 1820. 2662 Menschen lebten 1852 in der Stadt, 45 davon in den Einöden Weinberg, Lohmühle (früher: Bettelmühle), Reutberghof, Leonhardsruh, Walkmühle und Fallhaus. Er stellt den Flurer vor, der nicht nur den Felddieben auf der Spur war, sondern auch auf die Einhaltung der Grenzen achtete.
2015 beging die Stadt das Jubiläum „150 Jahre Eisenbahn“. Jürgen Huber zeichnet in seinem Beitrag „Der frühe Eisenbahnanschluss von Gunzenhausen“ die Geschichte der Bahn und des Bahnhofs nach. 1849 war die Strecke Gunzenhausen Augsburg-Hof durchgehend befahrbar. 2100 Arbeiter waren eingesetzt. Sie bevölkerten Gunzenhausen, das zu dieser Zeit gerade einmal 2700 Einwohner hatte. Bayerns König Max II. unternahm auf der Strecke Donauwörth-Gunzenhausen seine erste Eisenbahnfahrt. Um 1895 passierten täglich 45 Züge den Bahnhof. Der letzte Personenzug auf der Strecke Nördlingen-Gunzenhausen verkehrte 1985, der Güterverkehr endete 1994.
„Gemeinderecht, Gemeinheitsteilung, Flurbereinigung“. Das ist der Titel von Dr. Adolf Meiers Beitrag über die Nutzung der Flur in den Beispielsgemeinden Windischhausen, Heidenheim, Hechlingen, Hohentrüdingen, Gnotzheim, Ornbau und Mitteleschenbach. Er berichtet von der Mitteleschenbacher Dorfordnung von 1529 und erzählt die Episode, wonach es bei einer Strafe von zwei Gulden verboten war, vor dem Bartholomäustag Waldobst (Holzbirnen und –äpfel) „herabzuschütteln“. Dem Flurer war ausdrücklich das Recht zugesprochen, das Geld in der bischöflichen Gastwirtschaft zu vertrinken.
Das segensreiche Werk der Franziskanerinnen in Gunzenhausen würdigt Günter Dischinger („Das Franziskanerinnenkloster Gunzenhausen 1921-2013“). Zur Stammbesatzung gehörten in 92 Jahren 22 Schwestern, davon sechs Oberinnen.
Was hat der Schriftsteller Thomas Mann mit der Stadt an der Altmühl zu tun? „Thomas Mann, Gunzenhausen und die Rote Hilfe“ ist der Titel einer Geschichte von Dr. Martin Weichmann, die hier zu Lande das erste Mal zu lesen ist. Drei Gunzenhäuser Burschen hatten 1931 ein ketzerisches Lied gesungen und waren dafür eine Woche im Gefängnis gelandet. Über den Vorfall berichtete seinerzeit nicht der Altmühl-Bote und auch nicht das NS-Organ „Der Stürmer“, wohl aber das kommunistische „Tribunal“ in Berlin. Und woher rührt die Beziehung zum berühmten Schriftsteller? Thomas Mann hatte sich wiederholt gegen die missbräuchliche Anwendung des Gotteslästerungsparagrafen als Mittel zur Beschneidung der Meinungsfreiheit gewandt. So gelangte ihm auch der Vorgang in Gunzenhausen zur Kenntnis, über den das kommunistische Berliner Wochenblatt schrieb: „In Gunzenhausen haben Genossen einen Strafbefehl über eine Woche Gefängnis erhalten, weil sie durch Absingen des so populär gewordenen Lieds „3 Vaterunser bet´ ich nicht, an einen Herrgott glaub` ich nicht“ Gotteslästerung begangen haben sollen.“
„Die Katastrophe vom 16. April 1945“ titelt Werner Mühlhäußer und schildert den Bombenangriff auf Gunzenhausen, dem nach verlässlichen Angaben 141 Menschen zum Opfer fielen. In bisherigen Angaben war von 163 bis 160 Toten die Rede. Erstmals wird die vollständige Opferliste veröffentlicht. Fliegerangriffe hatte es zuvor schon im April 1941 und im Februar 1944 sowie in den ersten Monaten 1945 gegeben. Zu Schaden kamen dabei auch 358 Gebäude, davon wurden 24 völlig zerstört.
„Alt-Gunzenhausen“ , herausgegeben vom Verein für Heimatkunde Gunzenhausen, ist für 15 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich.








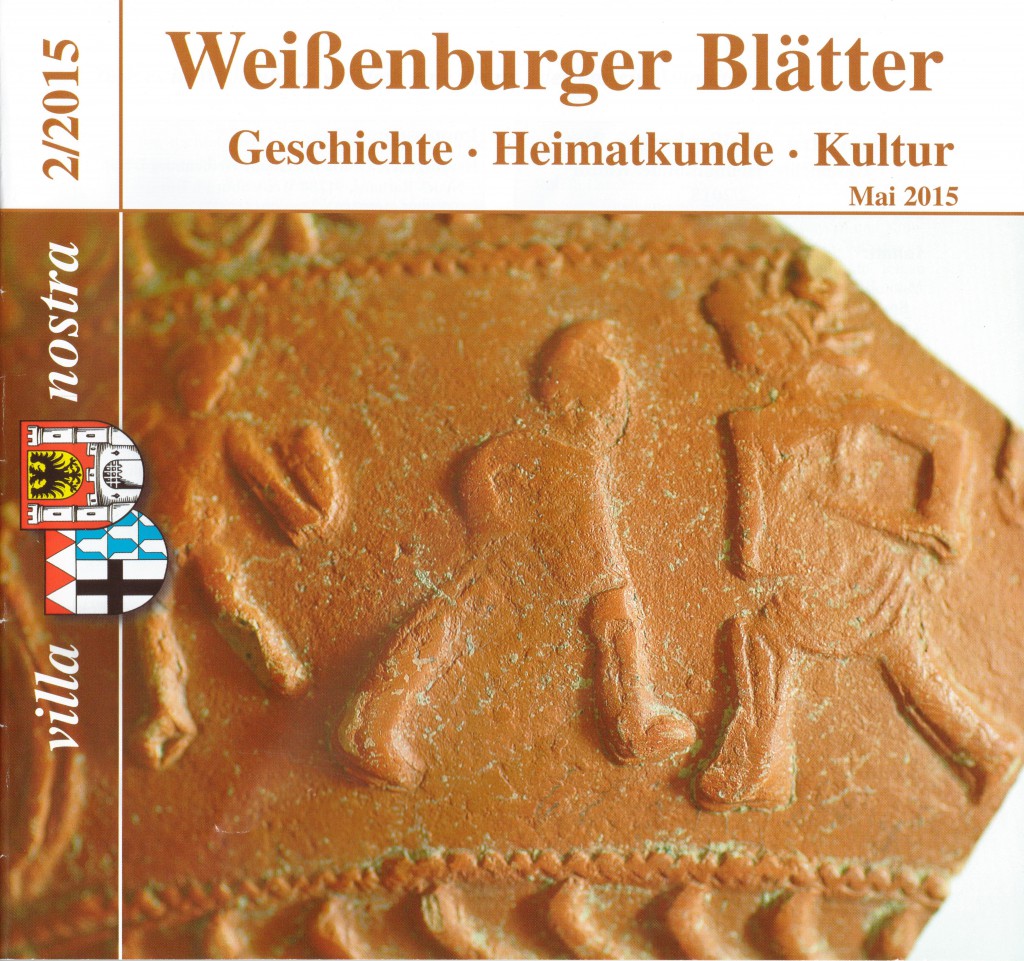

Neueste Kommentare