Kinogeschichte atmen mit dem Gruselklassiker „Nosferatu“

Als „Nosferatu“ Anfang der 1920er-Jahre in Berlin uraufgeführt wurde, trauten viele Besucherinnen und Besucher ihren Augen nicht. Über die Leinwand schlich ein gruseliger Vampirgraf mit Nagetierprofil, spitzen Zähnen und langen Gliedmaßen. Wo auch immer er auftauchte, er brachte Tod und Verderben über die Menschen. Verkörpert wurde er vom Theaterschauspieler Max Schreck, der zufällig nicht nur den passenden Namen für seine Rolle hatte, sondern so gut und überzeugend spielte, dass der ein oder andere dachte, einen echten Untoten gesehen zu haben. Auch deswegen gilt der von Friedrich Wilhelm Murnau gedrehte Stummfilm „Nosferatu – Symphonie des Grauens“ bis heute als einer der wirkungsvollsten Vampirfilme aller Zeiten. Das Horrorfilmgenre hat „Nosferatu“ maßgeblich beeinflusst, er wird immer wieder zitiert und zahlreiche ikonische Kameraeinstellungen sind aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Am 23. August 2024 wird die Stadt Gunzenhausen diesem Meisterwerk einen eigenen Abend widmen. Doch er wird nicht nur gezeigt, musikalisch begleitet wird der Film vom Gunzenhäuser Ensemble Dolcerando. Die Musiker feilen bereits seit Monaten am Setting und möchten die Stimmung der einzelnen Szenen mit Stücken aus unterschiedlichen Epochen einfangen. Herauskommen soll ein Stück Film-Hörkunst, das am 23. August 2024 um 19.30 Uhr im Falkengarten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.
„Nosferatu“ ist ein expressionistisches Meisterwerk und hat nachhaltig Spuren hinterlassen. Gerade die verwinkelten Kulissen und für die damalige Zeit ungewöhnlichen Außen- bzw. Naturaufnahmen sind sehenswert und geben viel Raum für Interpretation. Erstmals im Film drang der Schrecken in die Privat- und Intimsphäre der Menschen ein, keine der Figuren war ungeschützt und plötzlich sahen sich die Protagonisten mit übernatürlichen Phänomenen konfrontiert. Bewusst gesetzte Parallelen zur Spanischen Grippe und zum erst wenige Jahre zurückliegenden Ersten Weltkrieg sorgten zusätzlich für Angst beim Publikum.
Erzählt wird die Geschichte des Vampirgrafen Orlok, der sich unsterblich (Achtung Wortspiel) in die schöne Ellen verliebt. Seine Liebe lässt ihn nicht nur die Grenze zwischen Tod und Leben überwinden, er macht sich auch auf den Weg von Rumänien nach Deutschland in die kleine Hafenstadt Wisborg. Er trägt einen Mantel des Schreckens und dieser legt sich über jeden, der ihm auf seinem Weg begegnet.
Der Film „Nosferatu – Symphonie des Grauens“ wird in einer aufwendig restaurierten Fassung gezeigt und wird für einen Abend von der Friedrich Wilhelm-Murnau-Stiftung aus Wiesbaden für die Vorführung zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich wird es vor Beginn des Klassikers eine filmhistorische Einordnung geben, plus Informationen zur Entstehungsgeschichte und zum Nachhall. Was viele nicht wissen: Der Plot orientiert sich nicht nur an Bram Stokers Klassiker „Dracula“, sondern zitiert daneben serbische Legenden. Leider ist „Nosferatu“ aber auch ein Kind seiner Zeit. So wird Graf Orlok in der Forschung gelegentlich als Klischee des Ewigen Juden interpretiert. Am 23. August 2024 werden wir auch dieser These auf den Grund gehen.
Die musikalischen Lokalmatadore vom Ensemble Dolcerando bereiten sich bereits seit Anfang des Jahres auf den Abend vor. Sie dürfen dementsprechend gespannt sein und sollten sich dieses tolle Ereignis nicht entgehen lassen.
Der Stummfilmabend findet am Freitag, 23. August 2024, um 19.30 Uhr im Falkengarten, Dr.-Martin-Luther-Platz 4, 91710 Gunzenhausen statt (Einlass: 19.00 Uhr). Der Eintritt kostet pro Person 15 Euro. Bitte beachten Sie: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher sollten Sie sich zeitnah bei der Tourist Information der Stadt Gunzenhausen unter Tel.: 09831/508 300 melden und Ihr Ticket reservieren.

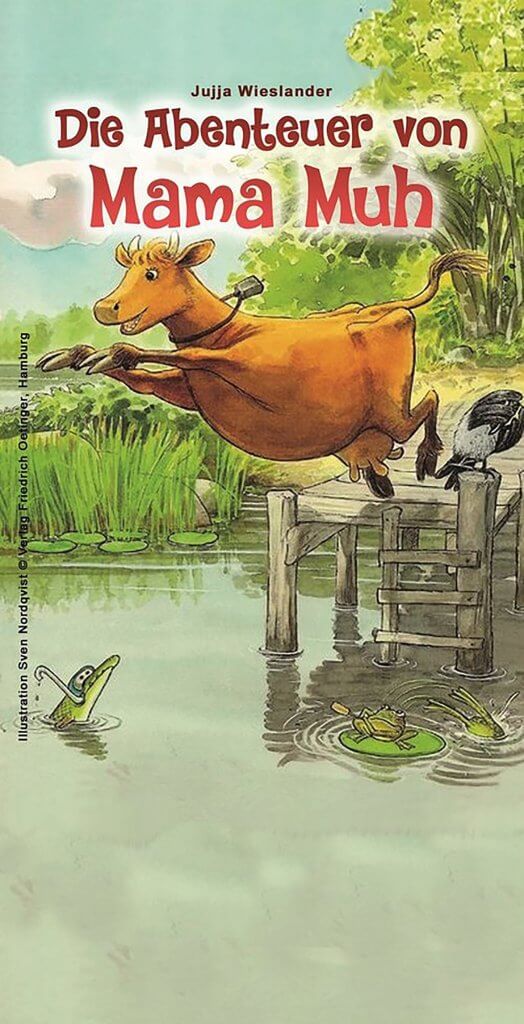



Neueste Kommentare