Band „Großbaustelle 793“ ist erschienen
Kaiser Karl der Große (748-814) ist der Namensgeber für den „Karlsgraben“, dem frühen Versuch, die Europäische Hauptwasserscheide bei Graben/Treuchtlingen zu überwinden und eine Schifffahrtsverbindung zwischen Rhein und Donau zu schaffen. Heute wissen wir, dass daraus erst im 20. Jahrhundert etwas geworden ist (Überleitung von Donau- und Altmühlwasser in das Regnitz-Main-Gebiet durch Realisierung von Altmühl-, Brombach und Rothsee).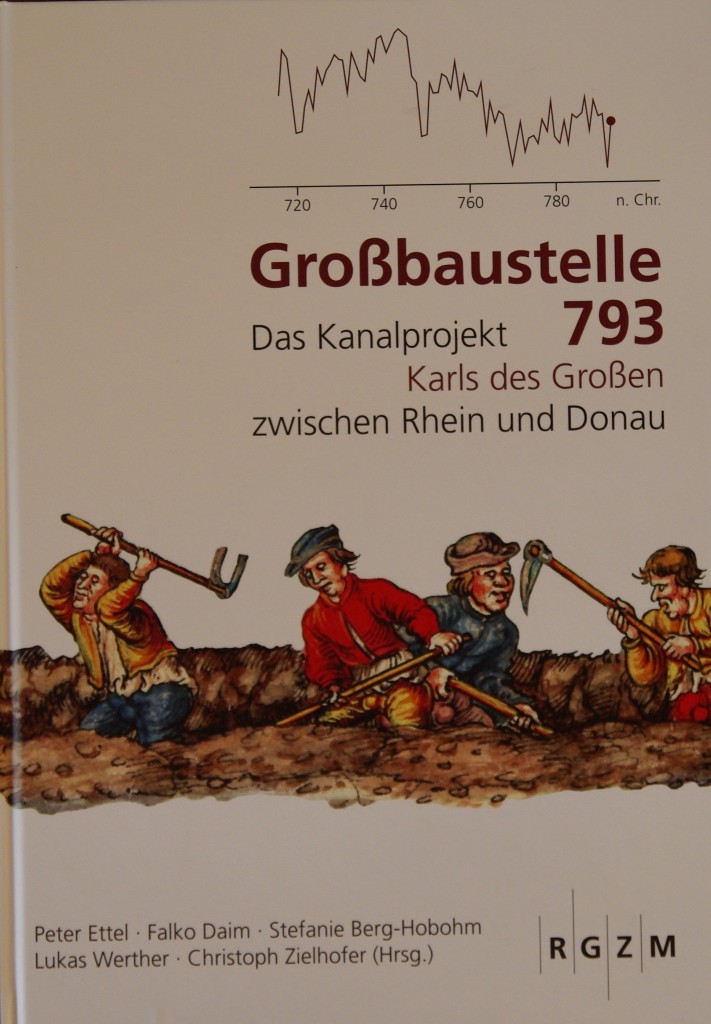
Dass sich der Kaiser des Römischen Reiches Deutscher Nation vor 1200 Jahren für das spektakuläre Projekt begeistern ließ, schreiben Wissenschaftler seinem Interesse für bis dato unerforschte Dinge zu. Er wollte damals schon weitere Erkenntnisse zur Zeitrechnung gewinnen, die Ursache der Sonnenfinsternis erkunden und Papst Leo III. sollte ihm erklären, ob tatsächlich in Mantua des Blut von Jesus Christus aufgefunden wurde.
Das Römisch-Germanische Nationalmuseum Mainz, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das Leibniz-Institut für Photonische Technologien an der Universität Leipzig und die Friedrich-Schiller-Universität Jena haben gemeinsam ein Begleitbuch zur 2014 präsentierten Ausstellung „Großbaustelle 793“ herausgebracht. Es ist das Ergebnis einer eineinhalbjährigen Arbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft („Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter“). Der „Verein für nichtstaatliche Archäologie in Franken“ hat den Band mit Beiträgen von 22 namhaften Autoren an seine Mitglieder weitergereicht.
Ähnliche Infrastrukturmaßnahme wie der Bau der „Fossa Carolina“ 793 sind den Wissenschaftlern nicht bekannt. Ob der „Karlsgraben“ jemals genutzt wurde ist unbekannt. Darüber streiten sich die Fachleute bis heute. In den Chroniken, die zwischen dem 11. bis ins 18. Jahrhundert erschienen sind, befassen sich Wissenschaftler und engagierte Laien mit dem Projekt. Der Name „Fossa Carolina“ geht übrigens auf den Weißenburger Johann Alexander Döderlein (1675-1745) zurück. Johannes Aventinus (1477-1574) begründet das Scheitern mit dem „Zorn der Natur“. 1911 sind erste Vermessungen im Rahmen der archäologischen Forschungen vorgenommen worden. Eine umfassende Erforschung hat 1992 der Archäologe Robert Koch vom Landesamt für Denkmalpflege betrieben. Seither haben die Wissenschaftler nicht nachgelassen, um die vielen Facetten des frühgeschichtlichen Bauwerks zu erforschen. Heute gehört der „Karlsgraben“ zu den beindruckendsten Bodendenkmalen Bayern. Die Besucher können sich in der Dauerausstellung in Graben bestens informieren.
„Großbaustelle 793“, Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung, 130 Seiten, repräsentative Aufmachung, ISBN 978-3-88467-241-9, Verlag des Römisch-Germanischen Nationalmuseums Mainz, 18 Euro.
Neueste Kommentare